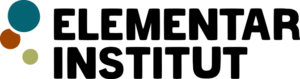Planung und Improvisation – ein Widerspruch?
von Axel Gundolf
23.01. 2023
Ich bin Planer. Ich bin sogar ein professioneller, man könnte sagen: ein gelernter Planer. Die meisten Jobs, die ich während meiner Tätigkeit im Medienbereich hatte, enthielten den Begriff „Planer“ schon im Titel.
Ich bin aber auch privat ein Planer. Zu den häufigsten Fragen, die meine Frau mir im Alltag stellt, gehören „Wann müssen wir los?“ und „Wird es heute regnen?“. Es scheint also selbstverständlich, dass ich viel Zeit mit Google Maps und der Wetter-App verbringe. Die Antwort, die ich eigentlich auf die Frage nach möglichem Niederschlag geben möchte, lautet immer: „Ich weiß es nicht.“. Das wäre ehrlich und korrekt, so gut die Meteorologie in Deutschland auch ist. Aber das würde meiner Frau nicht helfen. Darum sage ich so etwas wie: „Die Regenwahrscheinlichkeit heute ist extrem gering. Wenn überhaupt, scheinen später kleine Schauer möglich. Wie immer sage ich das ohne Gewähr.“ Das ist kein Witz, so rede ich wirklich manchmal.
Und gleichzeitig propagiere ich immer wieder die Prinzipien der Improvisation als fundamentale Philosophie – für das Arbeitsleben und auch das Leben insgesamt. Planen und improvisieren, das fühlt sich doch eigentlich zunächst nach einem Widerspruch an.
Aber da ist keiner. Im Gegenteil.
Was uns ein simples Spiel über das Wesen der Planung lehrt
Eine meiner liebsten Übungen für Improvisation ist die „1-Wort-Geschichte“. Sie ist so schön, weil sie so simpel und deswegen so radikal ist. Zwei oder mehr Menschen erzählen zusammen eine Geschichte – und zwar im Wechsel jede Person immer nur mit einem Wort, jeweils anschließend an das, was vorher schon gesagt wurde. Wenn man das noch nie gemacht hat, klingt das nach Quatsch und Chaos. Aber wir erleben in unseren Workshops und Trainings jedes Mal wieder, wie dabei innerhalb weniger Sätze wunderbare Geschichten entstehen.
Die 1-Wort-Geschichte zeigt auch sehr eindrucksvoll das Spannungsverhältnis von Plan und Wirklichkeit. Hinter jedem Wort, das ich der Geschichte hinzufüge, steckt ein Plan. Ich merke, wo in der Erzählung wir gerade stehen und entwickle auf dieser Basis eine Idee, wo ich mit der Geschichte hin möchte. Mein Wort ist also alles andere als ein Zufallsprodukt. Aber in dem Moment, wo die andere Person ihr nächstes Wort hinzufügt, aus ihrer Perspektive ebenso zielgerichtet, wird mein Plan mit hoher Wahrscheinlichkeit komplett in sich zusammenbrechen. Die Realität hat sich verändert. Ein neuer Plan muss her.
Ein Beispiel: Person 1 (P1) etabliert einen Protagonisten, Person 2 (P2) reagiert.
P1 beginnt mit: „Peter“
P2 ergänzt: „war“
P1: „ein“
Und hier hat P1 einen Plan. Sie stellt sich Peter als Feuerwehrmann vor. P2 müsste also jetzt einfach nur „Feuerwehrmann“ sagen. Macht sie aber natürlich nicht.
P2 sagt nämlich: „trauriger“
Wie bitte? Was hat P2 denn da vor? P1 hatte sich doch schon gedanklich so schön auf ihre Geschichte vom Feuerwehrmann vorbereitet!
Ein guter Improvisator erkennt sofort die zwei Möglichkeiten: Entweder bleibt P1 bei ihrer Idee vom Feuerwehrmann. Der muss dann aber jetzt definitiv ein trauriger Feuerwehrmann, und das wird die Geschichte maßgeblich beeinflussen (und interessanter machen). Oder P1 nimmt den Impuls der Traurigkeit auf und ändert ihren ursprünglichen Plan komplett, macht Peter vielleicht zu einem traurigen Beamten oder einem traurigen König. Auch alles interessant, die Geschichte wird in beiden Fällen spannend weitergehen.
Die einzige Option, die P1 nicht mehr zur Verfügung steht, ist die eigentlich geplante: Dass Peter einfach nur ein Feuerwehrmann ist, ganz ohne definierte Gefühlslage.
Festhalten oder Loslassen?
Dieses Beispiel wirkt vielleicht zunächst nur amüsant und trivial. Aber die Prinzipien hinter dem Spiel der 1-Wort-Geschichte sind näher an der Realität von Businessplänen, als die meisten Manager sich das eingestehen würden.
Wir machen einen Plan auf der Basis unseres Wissens, unserer Wahrnehmung der aktuellen Realität. Und auf dieser Basis entwickeln wir eine Vorstellung davon, wie die Welt sich entwickeln wird und was wir in dieser Welt vorhaben. Was wir aber meistens ignorieren ist die Tatsache, dass sich die Welt in jedem Moment ändert. Mal sind die Veränderungen gering genug, dass der Plan noch sinnvoll bleibt. Aber irgendwann – und meistens sehr viel früher, als wir das wahrhaben wollen – müssten wir den Plan eigentlich anpassen. Und manchmal ist das Naheliegendste sogar, den Plan komplett zu vergessen und einen neuen zu machen.
Unsere klug erdachten Pläne zu ändern, fällt uns aber naturgemäß extrem schwer. Und gerade da hilft die Haltung der Improvisation, die uns klar macht: Wer nicht in der Lage ist, seinen Plan jederzeit an neue Realitäten anzupassen, wird scheitern. Der Fluss von Produktivität und Wertschöpfung wird blockiert, Mitarbeitende verschwenden ihre Zeit und Energie mit sinnloser Beschäftigung.
Planung und Improvisation im Einklang
Wäre es also nicht vielleicht besser, einfach gar nicht mehr zu planen? Das ist ja die Vorstellung, die viele vom Begriff „Improvisation“ haben. Einfach irgendetwas machen, ausgedacht aus einer Laune heraus. Das ist aber keinesfalls so! Wie die 1-Wort-Geschichte funktioniert auch Improvisation nicht ohne Pläne. Jeder Musiker, Künstler, Sportler beginnt seine Arbeit mit einem Plan, einer Orientierung, einer Vorstellung dessen, was geschehen soll. Und diese Orientierung braucht es auch im Business. Ohne Plan herrschen Zufall und Beliebigkeit.
Aber: Wir müssen eben bereit sein, diesen Plan in jedem Moment so anzupassen, wie es die Realität – also zum Beispiel die Marktentwicklung – erfordert. Ohne Klagen über das Eintreten des Unerwarteten, ohne Beharren auf den Ideen einer vergangenen Realität. Das ist Improvisation, und das macht Unternehmen lebendig, flexibel und jederzeit sinnvoll handlungsfähig.
Wenn meine Frau mich also fragt, wann wir los müssen, dann kann ich ihr das nicht sagen, wenn ich unser Ziel nicht kenne, keine Ahnung vom Weg dort hin habe und nicht weiß, wie lange man zum Beispiel mit dem Fahrrad dort hin braucht. Ich brauche eine Karte, einen Plan. Und dennoch wird die Realität wahrscheinlich anders aussehen: Ampeln werden länger rot oder schneller grün sein, vielleicht ist der Berg steiler als gedacht, oder ein Reifen ist auf einmal platt. Der Mathematiker und Philosoph Alfred Korzybski hat das perfekt auf den Punkt gebracht, als er schrieb:
„The map is not the territory” – Die Karte ist nicht das Gebiet. Und ein Plan ist nicht die Realität.
Sie möchten planen und gleichzeitig auf alles vorbereitet sein? Melden Sie sich bei uns: gundolf@elementar-institut.de

Arbeit als Spiel
von Axel Gundolf
23.11. 2022
Es ist jetzt fast dreißig Jahre her, dass ich den Filmklassiker Forrest Gump im Kino gesehen habe. Damals war ich ein Teenager, und wahrscheinlich habe ich die Hälfte des Films nicht wirklich verstanden. Aber ich erinnere mich noch sehr lebendig an diese Szene: Forrest Gump sitzt auf der Bank an der Bushaltestelle und erzählt der Dame neben ihm, dass ihm als Football-Star, Kriegshelden und nationaler Berühmtheit von seiner Heimatstadt Greenbow, Alabama, ein großartiger Job angeboten worden sei. Und im nächsten Bild sehen wir ihn auf einem fahrbaren Rasenmäher sitzen und das Gras auf dem Football-Feld mähen. Dafür gab es Gelächter im Kino. Und die Szene geht noch weiter: Sein Freund, Lieutenant Dan, investiert Forrests Geld in Apple-Aktien, was Forrest Gump unglaublich reich macht. Und dann sagt Forrest Gump zu der Dame neben ihm diesen Satz:
“And because I was a gazillionaire and I liked doing it so much,
I cut that grass for free.“
Und auch da wurde natürlich gelacht. Alle Menschen, die den Film gesehen haben, wissen, dass Forrest Gump einen eher unterdurchschnittlichen IQ hatte. Und die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer haben auch verstanden, dass er dennoch (und vielleicht auch ein bisschen genau darum) über eine enorme Weisheit verfügte. Ich bin mir aber nicht sicher, wie vielen klar ist, welche profunde Erkenntnis in der Rasenmäher-Anekdote steckt.
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen?
Ein Mann, dem aufgrund seiner Verdienste alle Türen offen stehen sollten, freut sich wie ein Kind, dass ihm ein Job ausgerechnet als Platzwart angeboten wird? Und dann verzichtet er auch noch freiwillig auf sein Gehalt? Das mag ja schön sein in kitschigen Hollywood-Filmen, aber in der ernsten Realität unserer Arbeitswelt ist das doch eher naiver Quatsch – oder?
Irgendwann, an der Schwelle vom Kind zum Erwachsenen, wird uns klar gemacht, dass Arbeit und Vergnügen voneinander zu trennen sind. Es gilt: “Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.” Und, na klar: “Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps.” Und wer jetzt glaubt, das seien verstaubte alte Sprüche, der kann sich mal auf Business-Plattformen wie LinkedIn umschauen, wie oft die Maxime “Work hard, play hard” verkündet wird. Da geht es dann meistens um Vergnügungen im Kreis der Kolleginnen und Kollegen, wilde Partys, aufregende Teambuilding-Events, gemeinsame Reisen in die Sonne. Alles ein großer Spaß, den man sich aber vorher ausdrücklich durch besonders harte Arbeit verdient hat.
Ich glaube nicht, dass Forrest Gump auf seinem Rasenmäher solche Gedanken hatte. Wer Tom Hanks in dieser Rolle sieht, spürt seine pure Freude und tiefe Befriedigung. Und das nicht etwa bei einer Arbeit, die besonders kreativ oder überhaupt nur produktiv ist. Sie ist auch weder hoch angesehen noch hochbezahlt. “Work hard, play hard” gibt es nicht für Forrest Gump – weil Arbeit und Spiel bei ihm eins sind. Und darin besteht das Geheimnis dieser Geschichte.
Arbeit aus Spaß
Wenn wir als Erwachsene an “Spielen” denken, dann meist entweder als Beschäftigung von Kindern oder als Hobby mit einem festen Satz an Regeln, wie beim Fußball zum Beispiel. Ziemlich sicher denken wir nicht an unsere Arbeit, mit der wir unser Geld verdienen. Aber warum zwingen wir uns zu dieser künstlichen Trennung? Vielleicht weil wir nur dem einen Wert zugestehen, was wir auch in Euro beziffern können? Oder weil wir der Arbeit einen ernsthaften Zweck beimessen, sie als “sinnstiftend” betrachten, ihr einen “Purpose” zuordnen? Warum auch sonst sollten wir diese Arbeit erledigen?
“Aus Spaß” – das ist eine Antwort, die uns auf den ersten Blick irritiert. Sie scheint der nötigen Ernsthaftigkeit und Bedeutung unserer Arbeit nicht gerecht zu werden. Aber erlauben wir uns doch mal den Gedanken: Wie würde es denn aussehen, wenn wir unsere Arbeit einfach aus Lust und Laune machen würden? Vielleicht so wie Forrest Gump auf seinem Rasenmäher.
Kickertisch und Lego im Büro?
Wenn ich für die Betrachtung von Arbeit als Spiel plädiere, dann meine ich eines damit allerdings explizit nicht: den inzwischen zum Klischee verkommenen Kickertisch im Büro. Es geht nicht um eine unternehmenskulturell verordnete “Happiness”, die an unser Tagwerk gewissermaßen angeflanscht wird. Es geht um etwas, das viel tiefer in uns liegt: unsere Haltung, unser Blick auf das Leben insgesamt. Es geht um eine gedankliche Öffnung und das Einreißen der Barriere in unseren Gehirnen, die uns sagt, dass Arbeit in erster Linie ernst und hart zu sein hat, und Spaß bestenfalls ein willkommenes Nebenprodukt.
Forrest Gump hatte das Glück, mit seiner spielerischen Einstellung geboren zu sein, und vor allem die intuitive Weisheit, sich auch später im Leben nicht davon abbringen zu lassen. Wir dagegen müssen diese spielerische Haltung neu lernen, weil wir sie in der Kindheit zurückgelassen haben.
Und nochmal: Es geht dabei nicht darum, im nächsten Workshop mit Legosteinen zu arbeiten. Es ist eigentlich viel einfacher als das – und gleichzeitig schwer, weil es an unser Inneres geht. Aber das nächste Mal, wenn Sie in einem schwierigen Meeting sitzen, wenn die Ergebnisse schlechter sind als erhofft, oder wenn Sie Ärger mit einem Kollegen haben, erlauben Sie sich einfach mal den Gedanken: “Das hier ist ein Spiel, das wir zusammen spielen.” Und dann schauen Sie mal, was das mit Ihnen macht.
Sie möchten die Wertschöpfung erhöhen und gleichzeitig mehr Freude an der Arbeit? Melden Sie sich bei uns: gundolf@elementar-institut.de

Zwischen toter Steinwüste und wucherndem Chaos. Die Führungskraft als Gärtner.
von Dirk Schulte
26. April 2022
Als ich am Wochenende meinen Garten für die Aussaat vorbereitet habe, sah ich all das sogenannte Unkraut und die Rasensperren und die Maulwurfsverschrecker der Nachbarn. Und ich dachte daran, wie der Bauer in unserem Dorf demnächst wieder mit dem Glyphosat-Tank über die Felder fahren wird. Unterschiedliche Versuche, die Kontrolle über die Natur zu bekommen. Und wie wir gleichzeitig versuchen, bienenfreundliche Wiesen anzulegen, um das Ökosystem zu retten…
Mir fiel wieder ein, wie gut sich die Metapher des Gartens für einen Blick auf Unternehmen, Organisationen und Führung eignet. Denn genau wie ein Garten, ein Wald, oder jedes organische System, führen Unternehmen, beziehungsweise wirtschaftliche Systeme, ein Eigenleben. Und für Führungskräfte ist es außerordentlich hilfreich, sich auf diese Metapher wirklich einzulassen. Denn wir können hier sehr viel über Systeme, über Unternehmen und über Führung lernen.
Ein Garten, insbesondere ein Nutzgarten, erfordert ein gewisses Maß an Planung. Wir überlegen, was wir anpflanzen, was wir aussäen, und was der Markt – in diesem Fall vielleicht der Koch – braucht. Ich als Gärtner bin also der mächtige Geschäftsführer dieses kleinen organischen Systems.
Der Einfluss des Gärtners ist begrenzt
In der alltäglichen Praxis wird aber dann sehr schnell klar, dass mein Einfluss auf dieses System nur sehr begrenzt ist.
Es gibt zum Beispiel Jahre, in denen sich aufgrund der Wetterverhältnisse bestimmte Gemüsesorten nur sehr kümmerlich entwickeln. Dafür gibt es plötzlich wahnsinnig viele Zwetschgen, von denen in manchen Jahren aber wiederum ein Großteil von Würmern befallen ist. Immer verlässlich zu erwarten sind auch die sogenannten Schädlinge wie Schnecken, weiße Spinne, weiße Fliege oder Kohlweißlings-Raupen, die versuchen, das System von außen zu schädigen – oder zumindest ganz andere Ziele verfolgen als ich.
Ein anderer Punkt ist: Ab dem Zeitpunkt, wo ich mich beim Pflanzen für bestimmte Sorten entschieden habe, ist mein Einfluss auf die einzelnen Pflanzen sowieso sehr gering. Ich werde aus einer Zucchini keine Möhre machen. Und ich kann noch so sehr moralisch an die Gurkenpflanze appellieren: Erstens wird trotzdem aus ihr keine Tomate werden. Und zweitens werden meine moralischen Appelle auch nicht dazu führen, dass sie mehr Früchte entwickelt, wenn ich sie am falschen Standort angepflanzt habe oder sie nicht richtig gieße. Und meine MitarbeiterInnen werde ich auch nicht verändern. Und ich muss das auch nicht!
 Gärten – und eben auch Organisationen – sind lebendige Systeme. Das gilt es unbedingt zu akzeptieren!
Gärten – und eben auch Organisationen – sind lebendige Systeme. Das gilt es unbedingt zu akzeptieren!
Und was passiert, wenn Gärtner versuchen, mit aller Macht (!) die Kontrolle über ein lebendiges System zu erlangen, lässt sich in deutschen Gärten wunderbar beobachten. (vgl. „Gärten des Grauens“ auf Facebook oder Instagram). Was bleibt, ist eine tote Wüste ohne Leben und Kreativität.
Was wir aber machen können: Das Beet beobachten und Schlüsse aus dem Verhalten ziehen. Wir können Pflanzen umsetzen und schauen ob sie an dem neuen Ort besser gedeihen. Und wir können kreativ mit dem umgehen, was sich organisch entwickelt.
Unkraut als Potential sehen
Wenn zum Beispiel das sogenannte Unkraut Giersch anfängt zu wuchern, kann man es ausreißen. Allerdings ist Giersch so extrem robust und verbreitet sich dermaßen beharrlich, dass es spätestens im nächsten Jahr noch stärker zurückkommt.
Wenn ich die Ausbreitung von Giersch als Problem nehme und verschiedene Haltungen von Führung durchspiele:
- Die traditionelle tayloristische Führungskraft würde einen Schottergarten anlegen und notfalls Gift spritzen, um die Kontrolle auf Kosten der Lebendigkeit zu erlangen.
- Eine Laisser-Faire Führungskraft würde nichts tun und hoffen, dass das organische System sich selbst organisiert.
- Mit der Haltung der Improvisation dagegen sage ich: Egal was ich mir gewünscht und was ich geplant hatte – die Realität ist: Hier wächst Giersch. UND von hier aus mache ich kreativ weiter…und suche mir leckere Giersch Rezepte raus (wie zum Beispiel hier: https://www.smarticular.net/giersch-bringt-vitamine-mineralien-und-abwechslung-auf-den-teller/)
Denn so werde ich handlungsfähig und kreativ. Und ich lebe in der Realität, statt in einer Wunsch-Welt, die in Wahrheit nirgends existiert außer in meiner Vorstellung. Ich handle – aber erst nachdem ich die (momentane) Realität verstanden habe. Und ich weiß: Bald kann es wieder ganz anders aussehen.
Führungsimpulse im lebendigen System
Als Führungskraft kann ich entweder mithelfen, meine Organisation in einen Garten des Grauens zu verwandeln, alles mit Schotter zuschütten und jedes organische Leben, jede Lebendigkeit, jede Flexibilität vernichten. Oder ich kann zusehen, wie alles im Chaos versinkt.
Oder– und das wäre unsere Empfehlung: Mit der agilen Haltung der Improvisation kann ich Impulse setzen, beobachten, kleine Veränderungen vornehmen, das vitale Eigenleben des Systems unterstützen (und manchmal begrenzen). Denn alle Menschen (und Pflanzen) verfolgen immer positive Absichten und wollen wachsen und für jedes Verhalten gibt es gute Gründe. Dies zu verstehen, darum geht es. Verändern ohne Verstehen funktioniert nicht.
Genau so wie es nichts nützt, an eine Zucchini zu appellieren, bitte eine Aubergine zu sein.
Sie möchten nicht den Bock zum Gärtner machen? Melden Sie sich stattdessen bei uns: schulte@elementar-institut.de

Nostalgie: Schleichendes Gift in Organisationen
von Axel Gundolf
27.1. 2022
Seit mittlerweile fast fünfzig Jahren, spätestens zum kalendarischen Sommeranfang, wird in schöner Regelmäßigkeit der Schlager “Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?” von Rudi Carell ausgegraben. Dieser Text hier gibt nun endlich die abschließende Antwort auf die Frage des niederländischen Entertainers. Sie lautet: “nie”
Jetzt aber bitte nicht enttäuscht mit dem Lesen aufhören! Denn zur Enttäuschung gibt es gar keinen Anlass. Im Gegenteil: In der Erkenntnis, dass der “richtige Sommer” nie kommen wird, steckt ganz viel positive Haltung.
Letztlich geht es in Carells Hit um ein Gefühl, das uns allen bekannt sein dürfte: die Nostalgie. Laut Duden ist Nostalgie die “unbestimmte Sehnsucht” nach einer “vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit”, und zwar ausgelöst durch “Unbehagen an der Gegenwart”.
Corona als Nostalgie-Turbo
Und schwupp, schon sind wir im Hier und Jetzt der Corona-Pandemie. Eine solche lang anhaltende Krisensituation wirkt wie ein Nostalgie-Turbo. Denn wer kann schon von sich behaupten, angesichts der Lage nicht zumindest ein mildes Unbehagen zu verspüren? Viele Menschen haben verständlicherweise auch Angst, bis hin zu nackter Panik. Und über allem schwebt der Wunsch nach der “guten alten Zeit”, nach dem Zurück zur “Normalität”. Ich glaube, es ist alles andere als Zufall, dass man im deutschen Fernsehen 2021 Neuauflagen von Shows wie “TV total” (eingestellt 2015), “Wetten, dass…?” (2014) oder “Geh aufs Ganze!” (2003) sehen konnte. Sogar das im Original mit Hans Rosenthal zuletzt vor 35 Jahren ausgestrahlte “Dalli Dalli” wurde wiederbelebt, mittlerweile übrigens zum dritten Mal.
Und, ist das schlimm? Ist doch schön, wenn man ein bisschen in guten Erinnerungen schwelgen kann, mit warmen Gefühlen im Herzen. Oder nicht?
Klar, Nostalgie kann wohldosiert wunderbar sein. Aber sie birgt auch Gefahren, und das hat durchaus auch Relevanz für Unternehmen und andere Organisationen. Nostalgie ist per Definition eine Orientierung in die Vergangenheit, im Extremfall ist sie reaktionär. Die Erzählung von der “guten alten Zeit” kommt unschuldig daher, aber sie hindert einen positiven Blick auf die Gegenwart. Weil in der Nostalgie eine – in den meisten Fällen völlig unrealistische – Verklärung eines diffusen vergangenen Zustands steckt, kann die aktuelle Realität niemals mithalten. Das sorgt unweigerlich für Frustration.
Dieses Phänomen können wir besonders momentan in vielen Bereichen unseres Gesellschaftssystems beobachten. Dazu gehören auch Unternehmen. Haben Sie solche oder ähnliche Sätze schon mal in Ihrer Organisation gehört?
“Damals, als X noch unser Geschäftsführer war, da hat das hier noch richtig Spaß gemacht.”
“Damals, als wir nur ganz wenige Leute waren, da hatten wir hier eine richtige Start-up-Mentalität.”
“Damals, als wir noch richtige Partys feiern konnten, da war der Zusammenhalt viel besser.”
Bei solchen Aussagen spielt es dann auch keine Rolle, ob die neue Geschäftsführerin wichtige positive Veränderungen angestoßen hat. Oder dass das Unternehmen mit mehr Leuten viel bessere Arbeitsbedingungen bieten kann. Oder dass eher introvertierte Kolleg*innen in einer vergangenen Kultur möglicherweise regelmäßig benachteiligt wurden.
Dynamik-Bremse
Vor allem aber erschwert Nostalgie in Unternehmen die Haltung, dass die Zukunft (noch) besser werden kann als die Vergangenheit. Und ohne diese Hoffnung entsteht keine Dynamik, keine Kreativität, keine Innovation. Der Blick zurück steht somit im Widerspruch zu einem der wichtigsten Prinzipien aus der Improvisation: “Sei präsent!”. Nur wer den Fokus auf dem Gegenwärtigen hat, spürt die entscheidenden Strömungen innerhalb und außerhalb der Organisation. Natürlich müssen wir aus der Vergangenheit lernen, um zielführende Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Aber wenn dabei Nostalgie dominiert, läuft die Entwicklung an uns vorbei. Schon der Ökonom Keynes hat es auf den Punkt gebracht:
„The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones.“
Nun steht Nostalgie aber niemals in schriftlichen Unternehmensleitbildern oder Strategiepräsentationen. Sie entwickelt sich als organischer Teil der Unternehmenskultur, weil diese von Menschen geprägt wird, die sich eben wie normale Menschen verhalten. Darum ist es schwierig für Führungskräfte, mit diesem Phänomen umzugehen. Es spielt sich auf der Hinterbühne der Organisation, im Informellen, ab. Hier hilft dann oft eher ein externer Blick durch eine begleitende Beratung, die unvoreingenommen und individuell auf das System und seine Akteure schaut.
Wundermittel Akzeptanz
Zum Abschluss sei noch mal Rudi Carell aufgegriffen und meine auf den ersten Blick sehr pessimistische Behauptung, dass es niemals wieder richtig Sommer wird. Was bedeutet denn “richtig”? Wann ist ein Sommer ein “richtiger Sommer”? Laut Songtext bei “Sonnenschein von Juni bis September”. Aber – mal von den Bedingungen für Gesundheit, Klima und Landwirtschaft abgesehen – heißt das ja auch, dass man erst im Oktober beurteilen kann, ob der Sommer nun ein richtiger war. Und ist das nicht ein bisschen spät für Sommerfreude?
Stattdessen lässt sich auch hier wieder ein zentrales Prinzip der Improvisation anwenden: Akzeptieren, was ist. Jeden Tag, im Sommer wie im Winter, erst einmal annehmen, wie er ist und mit einer positiven Haltung begegnen. Schon die Stoiker haben verstanden, dass alles andere als unsere individuelle Wahrnehmung und unser Umgang mit dem Gegebenen außerhalb unserer Kontrolle liegt. Wenn wir das verinnerlichen liegt es einzig und allein in unserer Hand, und nicht in der von Meteorologen, wie es uns damit geht.
Der Klassiker “A Tale of Two Cities” von Charles Dickens beginnt mit den berühmten Worten:
“It was the best of times, it was the worst of times.”
Alles kann gleichzeitig gut und schlecht, falsch und richtig sein. Die Entscheidung liegt bei uns – auch an Regentagen.
Sie möchten dynamische Entwicklung und bewahren, was bewahrenswert ist? Melden Sie sich bei uns: gundolf@elementar-institut.de

Warum Neujahrsvorsätze nicht funktionieren (und wie sich trotzdem etwas verändern kann)
4.1. 2022
von Dirk Schulte
Anfang Januar. Die alljährliche Zeit der Neujahrsvorsätze. Auch in diesem Jahr werden sich viele von uns (wieder mal) vornehmen: weniger zu essen, gesünder zu leben, Sport zu machen, weniger Alkohol zu trinken…
In normalen Januaren schnellen die Anmeldezahlen in Fitnessstudios in die Höhe (ich habe mal einige Jahre als Fitnessstudio-Karteileiche verbracht, bewusst ohne zu kündigen. Ich dachte, die Kosten wären so schmerzhaft, dass sie mich irgendwann wieder an die Geräte zwingen. Dem war nicht so). In diesem Jahr sind es vermutlich die Abos von Fitness-Apps, Bestellungen von Heim-Trainern, Fitness-Trackern.
Spätestens im Februar kommt dann die Zeit der Ernüchterung. Als deprimierte, gescheiterte Existenzen schleichen wir durch die Wohnungen, vorwurfsvoll angeschaut von den Fitnessgeräten, verhöhnt von den verwaisten Musikinstrumenten (ich schaffe es inzwischen, mein Klavier fast völlig auszublenden aber ich weiss, es ist da…), leeren Schokoladenpackungen, vollen Obstschalen. Warum ist das so? Warum funktionieren Vorsätze so selten?
Magisches Denken
Das liegt am Zeitpunkt und an der inneren Haltung. Der willkürlich gewählte Zeitpunkt des ersten Januars eines neuen Jahres hat nichts mit unseren inneren Impulsen zu tun. Es ist ein rührend kindlicher Aberglaube, dass ein Datum im Kalender die Wahrscheinlichkeit einer grundlegenden Verhaltensänderung erhöhen soll. Magisches Denken, das nicht mehr funktioniert. Im Gegenteil, da wir schon mit so vielen Neujahrsvorsätzen gescheitert sind, erhöht der Zeitpunkt sogar die Wahrscheinlichkeit, dass die Veränderung nicht klappt. Ein paar Tage oder Wochen halten wir durch, aber dann…
Außerdem sind die Vorsätze meistens rein kognitiv, Verstand-gesteuert. Dieses neue Verhalten wäre vernünftig. Oder gesund. Oder erwachsen.
Damit landet der Vorsatz auf unseren To-Do-Listen zusammen mit den anderen unattraktiven, langweiligen, freudlosen Pflichtaufgaben. Vernünftig, aber unattraktiv. Sie lösen weder Freude noch Begeisterung aus. Nicht umsonst ist ein Kriterium der SMART Methode, dass Ziele attraktiv sein sollten.
Innerer Kritiker gegen inneres Kind
Denn sonst werden die Vorsätze nur Waffen in der Hand unseres inneren Kritikers. Aber der innere Kritiker behandelt uns streng, gnadenlos und seine Vorgaben sind nie zu erreichen. (Mehr zum inneren Kritiker gibt es in Episode 4 unseres Podcasts) So dass sich dann immer kurz später unser innerer Rebell, unser rebellisches Kind oder eine andere innere Person meldet, die alle guten Vorsätze torpediert, boykottiert und bekämpft. Und plötzlich ist das Glas Wein, der Schokoriegel, die Chipstüte, die Netflix Serie weggetrunken, weggegessen, weggeguckt. Und dann kommt der zweite Mechanismus: Die Selbstanklage und die innere Argumentation.
-
- Du hast versagt- du kannst das Ziel nicht mehr erreichen.
- Jetzt ist auch schon egal.
So dass uns letztlich innerer Kritiker und inneres Kind von verschiedenen Seiten attackieren. Und schon ist der Vorsatz in weiter Ferne und darüber hinaus fühlen wir uns schlecht. Und um dieses Gefühl zu kompensieren brauchen wir… mehr Wein, Schokolade, Netflix… Ein Teufelskreis. Jahr für Jahr.
Freundlichkeit und Realismus
Was ist der Ausweg aus dem Dilemma? Ein freundlicher Umgang mit sich selbst und ein Anerkennen der Realität. Denn wenn wir uns nicht als die sehen, die wir sind, sondern als die, die wir gerne wären, ist das der sichere Weg um uns negative Erfahrungen abzuholen. Wenn wir uns aber realistisch einschätzen, wissen wir dass wir Tage haben, an denen wir es nicht schaffen, konsequent zu sein. Und wenn wir uns erlauben, menschlich zu sein, statt einer unerreichbaren Perfektion nachzulaufen, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass sich wirklich etwas verändert. Und darüber hinaus ist es leichter, die Verhaltensänderung zeitlich begrenzt anstreben und dann zu schauen, ob wir Lust haben, das neue Verhalten fortzusetzen.
Denn wir brauchen positive Erfahrungen, um weiterzumachen. Gedanken reichen nicht, wir müssen spüren, dass es sich gut und richtig anfühlt. Nur dann entstehen neue Verbindungen zwischen unseren Synapsen. Also brauchen wir eine Mischung aus Disziplin und Freundlichkeit.
Und wenn wir einen Rückfall haben, hilft das zentrale Prinzip der Improvisation: Ja sagen, zu dem was ist… und dann flexibel weitermachen. Dann bleiben wir handlungsfähig. Im Gegensatz zu Selbstverurteilung. Die lässt uns oft erstarren oder versuchen die schlechten Gefühle mit ungesunden Verhaltensweisen zu überdecken.
Veränderungen in Unternehmen
Was hat das alles aber mit Organisationen und Unternehmen zu tun? Genau wie bei den Neujahrsvorsätzen wird hier oft davon ausgegangen, man könne durch gezielte Eingriffe in ein Unternehmen die Entwicklung dieses komplexen Gebildes steuern. Durch einen Prozess, der geplant und dann durchgeführt wird. Auch das ist ein rein kognitives Vorgehen. Mit dem Ziel, dass Prozesse, die von der Führungsebene oder Beratern als negativ identifiziert wurden, verändert werden. Nur nennt man das hier nicht gute Vorsätze sondern Change Management. Und wenn diese Veränderungen mit einer Haltung von Steuerung und Kontrolle versucht werden, sind sie genauso zum Scheitern verurteilt, wie der Vorsatz, nicht mehr zu rauchen, Sport zu machen oder sich gesünder zu ernähren. Zuerst wird sehr viel Energie aufgewendet und am Ende steht oft ein Gefühl von Frustration, Versagen und Schuldzuweisungen. Bis zum nächsten Silvester oder zum nächsten Change-Prozess, an den dann aber schon weniger Mitarbeiterinnen von vornherein glauben.
Was ist aber die Lösung? Was auch hier hilft, ist Geduld, eine freundliche Haltung und Neugier. Denn Menschen und Organisationen reagieren auf Druck mit Gegendruck und Widerstand. Aber wenn sie merken, dass positive Veränderungen passieren, entstehen Neugier und Offenheit. Und dann kann nachhaltige Veränderung passieren, die vielleicht nicht genau so geplant war, die aber in die gewünschte Richtung geht.
Dafür braucht es Impulse, Improvisation, Präsenz und Wachheit. Denn Organisationen sind lebendige Systeme und genau wie Menschen nicht wirklich steuerbar. Aber sie können sich trotzdem grundlegend verändern.
Und dabei helfen wir. Nicht durch Steuerung und Planung, die langfristig zum Scheitern verurteilt sind, sondern durch durch empathische Beobachtung, maßgeschneiderte Impulse und zielgerichtete Begleitung.
Sie möchten nachhaltige Veränderung statt wiederkehrende Frustration? Melden Sie sich bei uns: schulte@elementar-institut.de

Passionsspiele im Büro
10.11. 2021
von Axel Gundolf
Vor einigen Jahren hatte ich ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, der eine Gehaltserhöhung wollte. Ich habe abgelehnt. Seine Leistung, seine Rolle und das Gehaltsgefüge ließen das einfach nicht zu, und das habe ich ihm auch erklärt. Natürlich war der Mitarbeiter enttäuscht. Das ist verständlich und normal in einer solchen Situation. Was mir aber vor allem in Erinnerung geblieben ist, war seine Argumentation. Er sagte: “Aber ich stecke so viel Herzblut in meine Arbeit!”
Warum beschäftigt mich dieser Satz bis heute, lange nach unserer Zusammenarbeit?
Mit dem Wort “Herzblut” hat der Mitarbeiter das Thema Arbeit, und spezifisch das Thema Bezahlung, auf eine emotionale Ebene gebracht. Das ist in Ordnung, denn natürlich hat auch das an sich sehr rationale Modell von “Leistung gegen Geld” eine zutiefst persönliche Dimension. Der kalte Geldwert und der psychologische Selbstwert gehen an dieser Stelle eine Mischung ein, mit der man umsichtig umgehen muss. Gute Führungskräfte wissen das und finden für sich Wege, das zu tun.
Für mich steckt aber in dem “Herzblut”-Argument noch eine andere Komponente. Die Botschaft, die damals bei mir ankam, war: “Ich arbeite mit großer Leidenschaft – und dafür verdiene ich Anerkennung” – und darin liegt für mich eine große Schwierigkeit.
Die Idee, dass wir unserer Arbeit mit Leidenschaft nachgehen sollten, ist relativ neu. Früher war das höchstens Künstlern vorbehalten, vielleicht noch dem ein oder anderen besonders hingebungsvollen Handwerker. Der durchschnittliche Bauer stand beim Hahnenschrei aber wohl eher nicht mit dem Gedanken auf, heute das Feld mit ganz besonderem Feuer und Enthusiasmus zu bestellen. Auch die traditionelle Hausfrau hätte von sich wahrscheinlich nicht behauptet, für ihre Arbeit zu brennen und deswegen “die Extra-Meile zu gehen”. Arbeit musste erledigt werden, damit Brot auf dem Tisch, etwas Geld im Sparstrumpf und das Überleben der Kinder gesichert war. Den Job der Sinnstiftung übernahmen Religion, Dorfgemeinschaft und Familie.
Heute gibt es den Modebegriff des “Purpose”, der zumeist mit “Sinn” übersetzt wird, im Kern sogar als “Bestimmung” verstanden werden kann. Keine Marke, kein Arbeitgeber, so scheint es, kann sich erlauben, nicht auch diese hohen Ansprüche für die Mitarbeitenden zu erfüllen. Unternehmen werden zu einer zweiten Familie, Arbeit zu einer Art Ersatzreligion.
Natürlich ist überhaupt nichts Verkehrtes daran, seine tägliche Arbeit mit hoher Motivation und Engagement zu verrichten. Das altmodische Verständnis von Arbeit als frustrierender “Maloche”, die man nur für Geld erledigt, ist zum Glück längst überholt. Spaß bei und an der Arbeit ist ausdrücklich erlaubt. Und ja, man darf dabei auch gerne leidenschaftlich zur Sache gehen.
Der Begriff der Leidenschaft ist aber zweischneidig. Der erste Teil des Wortes sollte uns schon eine Warnung sein. Noch deutlich wird das beim Synonym “Passion”. Der Begriff steht schließlich sowohl für leidenschaftliche Hingabe – als auch für die christliche Leidensgeschichte. Und am Kreuz opfern sollte sich für seine Arbeit niemand.
Was ist also der richtige Weg im Umgang mit der Leidenschaft? In unserer Beratungsarbeit greifen wir gerne auf Prinzipien aus der Improvisation zurück. Eines davon lautet: “Sei engagiert!”. Nur wer sich mit all seiner naturgegebenen Neugier und Motivation – in anderen Worten seine Leidenschaft – einbringt, kann wirklich sein volles Potenzial ausschöpfen. Das hat aber im Kontext der Arbeit Implikationen für Führungskräfte und Mitarbeitende gleichermaßen.
Wenn die eigenen Leidenschaften so gar nicht zur Rolle in der Organisation und zur Erreichung der Unternehmensziele passen, dann sollte man sich dieses Missverhältnis bewusstmachen. Führungskräfte sind gut beraten, die Leidenschaften ihrer Mitarbeitenden zu kennen und für eine optimale Passung auf die jeweiligen Aufgaben zu sorgen. Als Mitarbeiter sollte man aber auch nicht erwarten, dass ein Unternehmen die Aufgabe der Sinnstiftung übernimmt. Diesen “Purpose” muss jeder eigenverantwortlich für sich definieren – und prüfen, ob die aktuelle berufliche Aufgabe dazu passt. Das eigene Herzblut ist zu wertvoll, um es sinnlos zu vergießen.
Wenn Sie mehr über gute Führung und ausgewogene Selbstführung erfahren wollen, melden Sie sich gerne bei uns: gundolf@elementar-institut.de

Warum wir von Zeit zu Zeit zu Höhlenmenschen werden sollten
23.8. 2021
von Axel Gundolf
Auch in diesem Sommer verbringen Millionen von Menschen ihren Urlaub in den Bergen – so wie auch ich mit meiner Familie. Und wahrscheinlich wurde bei vielen vorher der große Klassiker unter den Urlaubsfragen gestellt: “Ans Meer – oder in die Berge?” Beides gute Optionen, aber ich möchte noch eine weitere Alternative ins Spiel bringen: Warum nicht mal Urlaub in einer Höhle?
Die Idee wirkt vielleicht auf den ersten Blick etwas befremdlich. Aber ich finde, die Beschäftigung mit Höhlen und dem, was sie für uns Menschen bedeuten, lohnt sich. Denn das bringt uns wertvolle Erkenntnisse über Kreativität, Reflexion und Selbstführung.
Auf das Thema gebracht hat mich das Buch “Underland” des britischen Schriftstellers und Entdeckers Robert Macfarlane. Genau wie ich entwickelte Macfarlane schon in jungen Jahren eine Liebe zu den Bergen. Bei ihm waren es die schottischen Highlands, in meinem Fall die Tiroler Alpen. Dort lebten meine Großeltern. Bis heute gibt es für mich kaum ein erhabeneres und erfüllenderes Gefühl, als nach einer Wanderung auf einem Gipfel zu stehen und den Blick auf diese monumentale Landschaft auf mich wirken zu lassen. Ich kann dann schon fast körperlich spüren, wie sich meine Gedanken befreien und mein Geist sich entspannt. Der Kopf wird durchgelüftet für Inspirationen, neue Ideen können entstehen.
Genau an dieser Stelle hakt Macfarlane ein und bietet einen ungewöhnlichen Perspektivwechsel an. Wir Menschen schauen gerne und mit großer Faszination nach oben, hoch auf die Berggipfel und weit darüber hinaus. In einem klaren Nachthimmel können wir Sterne sehen, die Tausende von Lichtjahren von uns entfernt sind. Aber jetzt schauen Sie einfach mal in die entgegengesetzte Richtung, also direkt nach unten. Wir blicken bis zu unseren Füßen, darunter Boden, und Ende. Keine zwei Meter Distanz im Vergleich zur Unendlichkeit des Weltraums. Und dennoch tun sich im Untergrund in vielerlei Hinsicht faszinierende Welten auf.
Vor zwei Jahren haben Forscher in Indonesien ein Gemälde entdeckt, das wahrscheinlich das älteste bisher bekannte Kunstwerk der Welt ist. Es entstand vor über 40.000 Jahren. Und es befindet sich in einer Höhle. Neben der schwer zu fassenden zeitlichen Dimension hat mich an dieser Nachricht noch eine zweite Komponente fasziniert: Schon unsere frühesten Vorfahren haben sich unter die Erdoberfläche zurückgezogen und dort künstlerisch ausgedrückt. Inspirationen und Ideen entstehen vielleicht auf den Gipfeln dieser Welt – aber braucht es möglicherweise auch die Höhle als Rückzugsort für kreative Arbeit?
In unserer Beratungsarbeit weisen wir immer wieder auf die Bedeutung der Balance aus Anspannung und Entspannung hin. Unser Körper und unser Geist brauchen beides, die Herausforderung des Gipfels, aber eben auch den Rückzug in die Abgeschiedenheit und Ruhe der Höhle.
In diesem Zusammenhang habe ich mich daran erinnert, wie gerne ich als Kind Höhlen aus Decken, Kissen und Matratzen gebaut habe. Dieses wohlige Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit haben wir als Erwachsene in dieser puren Form nur noch selten. Aber wir brauchen Raum, um auch einfach mal ungestört allein sein zu können. Diese Höhlen sollten wir uns gezielt suchen, zum Beispiel durch regelmäßige Meditation und bewusste Pausen ohne Impulse von außen. Sie werden schnell merken, dass sich Gipfel deutlich leichter erklimmen lassen, wenn man vorher tiefe und echte Ruhe genossen hat.
Führt man den Blick ins Innere und Dunkle metaphorisch noch einen Schritt weiter, kommt man auf das, was wir in unserer Praxis als “innere Arbeit” bezeichnen. Der Autor Robert Macfarlane bringt das wunderbar auf den Punkt:
“We all carry Underlands within us, but only rarely acknowledge their existence.“
Den Blick nicht nur nach oben zu richten, auf Ziele und Visionen, sondern eben auch unter die eigene Oberfläche, fällt uns oft schwer. Unsere Business-Welt ist auf äußere Erfolge fixiert. Extrovertiertheit wird oft fälschlicherweise als notwendige Führungsqualität betrachtet. Da erscheint der Blick in die dunkle Höhle des Selbst als überflüssig, sogar kontraproduktiv.
Aber er lohnt sich. Gute Führung basiert immer auf guter Selbstführung. Denn nur wer sich selber gut kennt und versteht, kann wirklich präsent, engagiert und authentisch in seiner Arbeit sein und auf diese Weise andere führen. Oder in den Worten von Robert Macfarlane:
„Darkness might be a medium of vision, and descent may be a movement towards revelation.“
Wenn Sie mehr über gute Führung und ausgewogene Selbstführung erfahren wollen, melden Sie sich gerne bei uns: gundolf@elementar-institut.de

It’s funny cos it’s true
28. Juni 2021
von Axel Gundolf
Ich muss vorab warnen: In diesem Text werde ich die These aufstellen, dass etwas “typisch deutsch” ist. Und dann geht es dabei auch noch um Humor. Da wird uns Deutschen ja global nachgesagt, wir hätten ganz einfach keinen. Gerade die Briten erzählen gerne diesen Witz:
-
- Do you want to know a fun fact about Germany?
- There is no fun in Germany. Go back to work!
Ich beschäftige mich viel mit Humor und bin ein großer Fan aller Arten von Comedy. Auch in unserem Beratungs- und Trainingsalltag spielt Humor eine wichtige Rolle. Inhalte lassen sich auf unterhaltsame Weise sehr viel einfacher vermitteln – und wir selber haben dann auch mehr Spaß bei der Arbeit.
Da ich viel Comedy-Content aus unterschiedlichen Ländern konsumiere, ist mir etwas aufgefallen, dass ich auch für das Thema Arbeit und Führung relevant finde. Ich glaube nämlich, dass wir Deutschen etwas ganz Essenzielles falsch machen. Wenn es so etwas wie “typisch deutschen” Humor gibt, dann versäumt er es, ein grundlegendes Prinzip anzuwenden, das vor allem die Amerikaner viel besser verinnerlicht haben. Und dieses Prinzip bringt nicht nur das Comedy- Business auf ein höheres Level, sondern wirklich jedes Business. Und es lautet:
“Sei persönlich.”
Das Prinzip stammt aus der Improvisation. Kurz gesagt geht es darum, dass wir in jeder Hinsicht am effektivsten sind, wenn wir einfach wir selbst sind. Dann verschwenden wir keine Energie darauf, etwas vorzutäuschen, von dem wir denken, dass andere das von uns erwarten oder dass es besonders gut ankommt. Stattdessen erreichen wir Menschen – und letztlich auch unsere Ziele – mit mehr Energie und unserem vollen Potenzial. Und das funktioniert in allen Lebensbereichen, in der Comedy genauso wie bei der Führung von Teams. Wir sind wirkungsvoller und agieren nachhaltiger, wenn wir menschlich authentisch sind.
Im angelsächsischen Raum gibt es diese Tradition, sinnbildlich zusammengefasst in dem Ausspruch: “It’s funny – cos it’s true!”.
Und diese Art von Wahrhaftigkeit bringt immer wieder große Meisterwerke der komischen Kunst hervor. Gerade vor wenigen Tagen habe ich wieder mal ein besonders eindrucksvolles Beispiel gesehen: das neue Netflix-Special des hierzulande kaum bekannten US-Comedians Bo Burnham. Das trägt den sehr treffenden Namen “Inside”, denn zum einen hat Burnham sein komplettes Programm während der Corona-Pandemie alleine in seinem Wohnzimmer gedreht. Zum anderen verarbeitet er dort völlig ungefiltert sein Innenleben, seine Gedanken und Gefühle. Die sind wahrlich nicht immer brüllkomisch, aber gerade das macht die Tiefe dieses Films aus.
Ähnliches gilt für eins meiner liebsten Stand-up-Programme überhaupt, “Nanette” der australischen Komikerin Hannah Gadsby (ebenfalls auf Netflix zu sehen). Die feuert dort eine Mischung aus Gags, Sozialkommentaren und Lebensgeschichte ab, dass es einen umhaut. Es geht um Gadsbys persönliche Traumata, ihre Diskriminierungserlebnisse als Homosexuelle und ihren Autismus. Hört sich nach schwerer Kost an, ist aber sehr berührend – und eben unglaublicherweise trotzdem irrsinnig lustig.
Zugegeben, diese beiden Beispiele sind extrem und sicherlich Geschmackssache. Deutlich wird meine These aber auch an der wiederum sehr populären Comedy-Serie “The Office”. Das britische Original von und mit Ricky Gervais war ein ätzender und schonungsloser Blick in die Untiefen des Büroalltags. Das war große Comedy-Kunst und mit Sicherheit stilbildend, aber nach 12 Episoden in dieser Ausrichtung auch auserzählt. Die US-Adaption wird im Vergleich oft als “weichgespült” betrachtet. Richtig ist, dass sie deutlich emotionaler ist, weil sich die Charaktere entwickeln dürfen, auch Beziehungen eine Rolle spielen und es einfach insgesamt menschlicher zugeht. Und auf einmal trug dasselbe Setting die Geschichte über mehr als 200 Episoden. Gefühle und kommerzieller Erfolg schließen sich also offensichtlich keinesfalls aus.
Und was ist mit uns Deutschen? Beim weiteren Nachdenken darüber, warum der deutsche Humor nicht gerne persönlich wird, ist mir die bei uns weit verbreitete Tradition der humoristischen Kunstfigur aufgefallen. Deutscher Humor verkleidet sich gerne. Er setzt sich Perücken auf wie Helge Schneider oder Atze Schröder. Er schneidet Grimassen wie Didi Hallervorden oder Martin Schneider. Manchmal reicht auch schon eine Mütze, wie aktuell bei Torsten Sträter oder früher Tom Gerhardt. Die sind alle oft durchaus äußerst lustig, aber wirklich berührt werden wir nicht, letztlich bleibt alles an der Oberfläche des schnellen Lachers.
Warum ist das relevant? Und warum spielt das auch für das Thema Führung eine Rolle? Weil ich glaube, dass Humor und Komik ein wichtiger Teil von Kultur sind. Und Kultur findet ja nicht nur auf Bühnen statt, sondern prägt unser gesamtes Leben, als Gesellschaft und individuell. Aber wenn wir beim Lachen schon nicht persönlich werden können, wie sollen wir es dann bei vermeintlich “ernsten” Tätigkeiten wie Arbeit sein?
Somit ist dieser Text am Ende ein Plädoyer. Führungskräfte dürfen und sollen sich trauen, mehr Persönlichkeit zu zeigen – gerade weil uns Deutschen das offensichtlich nicht in die kulturelle Wiege gelegt wurde. Umso wichtiger ist es, diese menschliche Ebene auch gerade in der Arbeitswelt zuzulassen. Das ist gar nicht so einfach, weil wir durch unsere äußeren Prägungen darauf ausgerichtet sind, bestimmte Rollen zu spielen. Aber wenn wir diese Verkrampfung lockern können, steigern wir unsere Wirksamkeit.
Wie viel Potenzial darin steckt und was das auslösen kann, haben vor kurzem übrigens ausgerechnet der Mützenträger Torsten Sträter und die Kunstfigur Kurt Krömer gezeigt. In einer sehens- und bemerkenswerten Episode des Formats “Chez Krömer” haben diese beiden durch und durch deutschen Komiker mitten in der Sendung angefangen, ganz offen über ihre Erfahrungen mit schweren Depressionen zu sprechen. Dadurch waren die beiden kein Stück weniger lustig, haben in mir aber mindestens einen neuen Fan gewonnen.
Und wer glaubt, dass sich solche Themen nicht mit den harten Anforderungen des Geschäftslebens vereinbaren lassen: Das zugehörige Video gehört mit etwa 2 Millionen Abrufen auf YouTube zu den erfolgreichsten Episoden des Formats.
Wenn Sie uns mal persönlich kennenlernen wollen, melden Sie sich doch einfach bei uns. gundolf@elementar-institut.de

Waiting for the Weekend?
9. Juni 2021
von Axel Gundolf
“Hi, wie geht’s?”
“Naja, Montag halt.”
“Tja, da sagst du was.”
Schon mal so oder ähnlich gehört? Auf dem Gang, am Telefon, morgens im Aufzug? Alltäglicher Büro-Smalltalk, nichts Besonderes, kurzer netter Austausch. Erfüllt seine Funktion, füllt die Stille. Und nebenbei versichert man sich, dass man sich einig ist, dass man richtig liegt, dass man zum gleichen Stamm gehört.
Aber was sagen wir hier eigentlich?
Mich irritieren solche Konversationen. Denn hinter diesem harmlosen Austausch steckt eine Botschaft, die für viele so selbstverständlich zu sein scheint, dass wir sie gar nicht mehr hinterfragen. Wir haben es offenbar als allgemeingültig akzeptiert, dass mit bestimmten Wochentagen ganz automatisch auch bestimmte Stimmungen und Gefühle verbunden sind.
Das ist so klar, dass sogar die Popkultur auf die Chiffren zurückgreifen kann, und jeder versteht das sofort. “I don’t like Mondays”, sangen die Boomtown Rats schon vor über 40 Jahren, und der Song hat sich bis heute als Hymne aller Montagsmüden erhalten (auch wenn das Lied einen ganz anderen, deutlich komplexeren Hintergrund hat). Der Gegenentwurf dann etwa ein Jahrzehnt später von The Cure:
I don’t care if Monday’s blue
Tuesday’s grey and Wednesday too
Thursday, I don’t care about you
It’s Friday, I’m in love
1994 setzte die dänische Sängerin Whigfield mit “Saturday Night” dann nicht nur einen der nervigsten Nr. 1 Hits aller Zeiten in die Welt, sondern zementierte auch noch mal felsenfest die Gewissheit: Samstage sind ganz klar die besten Tage der Woche. Denn Montage sind ja zum Hassen da, Dienstag bis Donnerstag ist es auch nicht viel besser – und ab Freitag kommt dann die Erlösung. Das Wochenende ist die Zeit, wo alles gut wird, wo sich unsere Träume, Sehnsüchte und Bedürfnisse erfüllen. Ganz schön viel für zwei kleine Tage. Und was sollen wir eigentlich mit dem Sonntag anfangen? Ach ja: “Tatort” schauen. Gott sei dank gibt es die Programmplaner der ARD.
Ich mag gute Popsongs, und ich finde es schön, wenn uns das gute alte Fernsehen liebgewonnene Rituale liefert. Aber ich will mein Leben nicht auf zwei Tage in der Woche beschränken. Was ist denn, wenn das Wochenende mal gar nicht so toll ist? Dann muss ich wieder fünf Tage durchhalten, bis die nächste Chance auf eine gute Zeit kommt. Das ist doch viel zu viel Druck auf zwei Tage, die doch höhere Mächte verschiedener Weltreligionen mal als Tage der Ruhe und des Innehaltens festgelegt haben.
Und jetzt mal ein ganz irrer Gedanke: Was wäre denn, wenn ich es mir erlaube, auch schon an einem, sagen wir mal, ganz normalen Dienstag eine gute Zeit zu haben? Oder wenn ich mich mittwochs Hals über Kopf verliebe, statt wie vorgesehen auf den Freitag zu warten? Ich könnte sogar an einem Montag in irgendeinem Büro in Deutschland so etwas wie Begeisterung verspüren. Klingt unfassbar, aber es ist definitiv möglich. Habe ich selber schon erlebt!
Das klingt vielleicht alles etwas banal, genauso wie der eingangs wiedergegebene Smalltalk. Aber dahinter steckt die große Frage, wie wir eigentlich leben und arbeiten wollen. Mit welcher Haltung machen wir das, was wir gerade machen? Wollen wir unsere Arbeit einfach hinter uns bringen, um dann in der sogenannten “Freizeit” endlich Erlösung zu finden? Sehnen wir uns nach der nächsten Gehaltszahlung, damit wir das hart verdiente Geld dann in Produkte und Erlebnisse stecken können, die uns für dieses Leiden entschädigen? Da muss es doch noch mehr geben, oder?
Ja, gibt es. Und die gute Nachricht ist, dass es wirklich jeder Mensch anders haben kann. Sieben Tage die Woche eine gute und erfüllte Zeit, das ist kein Luxus für irgendeine Elite, von dem der “kleine Mann” oder die “kleine Frau” nur träumen können. Das ist eine Frage der Haltung, ganz einfach – und doch manchmal so schwierig in der Umsetzung.
Man könnte zum Beispiel ganz einfach damit anfangen, mal in der Kiste mit den Klischees aufzuräumen, die viele von uns im Kopf haben. Da stecken nämlich oft noch Vorstellungen von Arbeit drin, die eher aus der Frühzeit der Industrialisierung stammen. Die unerbittliche Stechuhr, der böse Chef, der Feierabend als Erlösung. Schauen wir doch mal mit einem frischen Blick auf das, womit wir einen Großteil unserer wachen Zeit verbringen. Gönnen wir uns einen positiven Blick ohne Zynismus auf unsere Arbeit. Und machen wir uns bewusst: Wir entscheiden uns jeden Tag freiwillig, genau diese Arbeit zu machen. Geld verdienen kann man nämlich auch woanders.
Letztlich geht es ganz einfach darum, unsere Tage bewusst und engagiert zu erleben – und zwar alle Tage der Woche, nicht nur die offiziell für Spaß vorgesehenen. Hören wir auf, unsere Freuden auf eine imaginäre Zukunft zu verschieben, können wir stattdessen das Schöne und Begeisternde im Hier und Jetzt entdecken. Wenn man einmal damit anfängt, eröffnen sich ganz neue Perspektiven. Und auf einmal erzählen Sie der Kollegin im Aufzug, wie gut Ihnen das Frühstück am Montagmorgen geschmeckt hat, auf welches Meeting Sie sich heute am meisten freuen, und dass es total schön ist, mit Menschen wie ihr zu arbeiten.
Und extra für diesen Moment ist mir dann sogar noch der passende Popsong eingefallen:
Let’s go walking through the park today
I love Sunday Mondays any day
When the skies are blue and it’s not grey
I’ll take Sunday Mondays any every day
(Vanessa Paradis – Sunday Mondays)
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, wie auch Sie mehr Begeisterung in Ihre Arbeit bringen können, dann melden Sie sich doch einfach bei uns. Wir unterstützen Sie, Ihr Team oder Ihr Unternehmen gerne: gundolf@elementar-institut.de